Den Umbruch der Welt prägt China mit strategischer Dominanz. Das trifft auf Widerstand. Vor allem die USA sind gewohnt, den Ton anzugeben. Politisch, wirtschaftlich, militärisch. Das Ringen beider Mächte um Stärke und Einfluss gipfelt in Zöllen und Export-Beschränkungen. Kann Europa Nutznießer des Streits der Großmächte sein?
Inhalt
„China nimmt unser Land aus“, sagte Donald Trump im Jahr 2011. Damals war er Unternehmer. Diese Haltung treibt ihn auch als Präsident der USA um. Und so brach er den größten wirtschaftspolitischen Konflikt unserer Zeit vom Zaun. Mit Zöllen von bis zu 145 Prozent auf chinesische Waren, die in die USA exportiert werden, wollte Trump China bestrafen. Bestrafen dafür, dass das Reich der Mitte mehr Waren in die USA liefert als umgekehrt und sich damit in den Augen des Präsidenten bereichert.
Man nennt das Handelsbilanzdefizit. Das kann allerdings die eigenen Unternehmen im internationalen Wettbewerb beeinträchtigen oder die Verschuldung des Landes mit dem Defizit erhöhen, weil es viel Geld ausgeben muss für eben diese importierten Waren.
Nun sind die USA das höchstverschuldete Land der Welt hinter dem Sudan. Das hat viele Gründe. Trotz der rekordhohen Schulden will der Präsident seine Wahlversprechen finanzieren. Etwa durch Steuersenkungen und durch Zölle. Dazu hat Trump ein Gesetz erlassen – und durch den Kongress bekommen, selbst gegen Widerstand aus den eigenen Reihen: Das „One big beautiful bill“. Die Rechnung scheint aufzugehen: Die US-Wirtschaft wächst mit drei Prozent – trotz der Schulden.
Der Ursprung des Konflikts: Trumps Kampf gegen das Handelsdefizit
Auf der Internetplattform Reddit wird das Gesetz von Trump überwiegend gefeiert. „Amazing. The best bill ever.“ – Wunderbar, das beste Gesetz aller Zeiten. „It is breathtaking in its scope. It’s an entire term’s worth of legacy in a single bill.“ –
Es ist atemberaubend in seinem Umfang – alle wichtigen Themen in einem einzigen Gesetz – „This means Trump will accomplish most of his campaign promises“. – Trump wird die meisten seiner Wahlversprechen halten.
Die Steuerzahler in den USA sollen im kommenden Jahr um durchschnittlich 3.752 US-Dollar entlastet werden. Das errechnete die Denkfabrik Tax Foundation. Das ist viel Geld in einem Land, in dem die Lebenshaltungskosten noch höher sind als in Deutschland. Besonders viel Geld geht in den USA für Miete, Krankenversicherung, Kita- und Studiengebühren drauf, während Strom und Benzin günstiger sind als hierzulande. Und so hoffen viele Menschen auf Entlastung.
Doch einige realisieren: Die Versprechen werden teuer erkauft: „Things I don‘t like – it adds trillions to the debt..“ – Was ich nicht mag: unsere Schulden steigen um Billionen. „Don‘t like the $5 trillion debt limit increase.“ – Ich finde die 5 Billionen Erhöhung der Schuldengrenze nicht gut.
Ist das das versprochene Goldene Zeitalter? Man wird sehen. Erst einmal muss Geld ins Staatssäckel, deswegen die Zölle. Gegen rund 100 Länder.
Chinas strategischer Trumpf: Das Monopol auf Seltene Erden
Ein Land hingegen setzte sich massiv zur Wehr: China. Nannte die Abgaben einen „Witz“ und holte zum Gegenschlag aus: China verhängte Export-Beschränkungen bei Seltenen Erden in die USA. Das sind spärliche Rohstoffe wie Neodym oder Lanthan. Sie werden in der Automobil-, Windkraft- oder Mobilfunk-Industrie gebraucht. Kein Auto oder Handy funktioniert ohne.
Damit geht Chinas Kalkül auf. Die USA geben nach im Zollstreit: China besitzt nämlich rund 70 Prozent der Seltenen Erden weltweit und 90 Prozent der Verarbeitungskapazitäten. Volkswirtschaften wie die USA, Schweden oder Norwegen, die auch Seltene Erden haben, können sie nicht verarbeiten und schicken sie dafür nach China.
Wegen der Beschränkungen und Knappheit mussten US-Auto-Hersteller wie Ford die Produktion drosseln. Das brachte den US-Präsidenten in die Bredouille. Denn ein Goldenes Zeitalter hatte er auch seiner Auto-Industrie versprochen. China zwang ihn zum Einlenken im Zollstreit. Prompt durften US-Unternehmen wieder leistungsstarke KI-Chips nach China liefern. Kein Wort mehr, dass die nationale Sicherheit der USA gefährdet sei, wenn China in Sachen KI aufschließt. Kurz: Mit Seltenen Erden hat China ein zu großes Druckmittel.
Europas Rolle im Handelskonflikt: Fünf spürbare Folgen
Und Europa? Oft wurde der Handelskrieg zwischen den USA und China als Chance für Europa, für die EU gewertet. Doch die EU ist selbst ins Kreuzfeuer des wirtschaftspolitischen Konfliktes geraten. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht.
1. Sinkende Nachfrage und „Buy American“-Strategie
Die Wirtschaft der EU leidet unter Nachfrage-Rückgang, denn die USA wie China sind wichtige Absatzmärkte für Europa. Aber der Handelsstreit hat die Wirtschaft Chinas geschwächt, europäische Maschinen oder Luxusgüter werden weniger nachgefragt. Gleichzeitig drängt Washington mit seiner „Buy American“-Strategie europäische Unternehmen aus dem Markt. Wer nicht in den USA produziert, wird mit hohen Import-Zöllen belegt. Die Folge: Die Exporte deutscher Autos in die USA gingen zurück, ebenso die französischer Handtaschen und italienischer Maschinen.
2. EU gerät selbst ins Visier der Zölle
Die USA wenden Zölle auch gegen die EU an. 15 Prozent auf EU-Importe. Ein Kompromiss. Teuer erkauft: Die EU muss dafür Energie im Wert von 750 Milliarden US-Dollar abnehmen und rund 600 Milliarden US-Dollar in den USA investieren. Und darf ihrerseits keine Zölle auf US-Waren verlangen.
3. Umleitungseffekte durch chinesische Überkapazitäten
Zugleich haben die Maßnahmen der USA gegen China unliebsame Nebenwirkungen auf Europa: Beispiel Stahl: Die chinesische Stahl-Produktion wächst seit Jahren, doch nun braucht China selbst nicht mehr so viel (Konjunkturschwäche) und kann weniger in die USA exportieren (50 Prozent Zölle). Die Folge: China braucht neue Absatzmärkte. Da kommt Europa gerade recht. Der teure Standort, der sich mit Asiens Preisen nicht messen kann. Zu teuer die EU-Arbeitskräfte und die Energie. Die Folge: Europas Unternehmen werden ihren teuren Stahl schwieriger los.
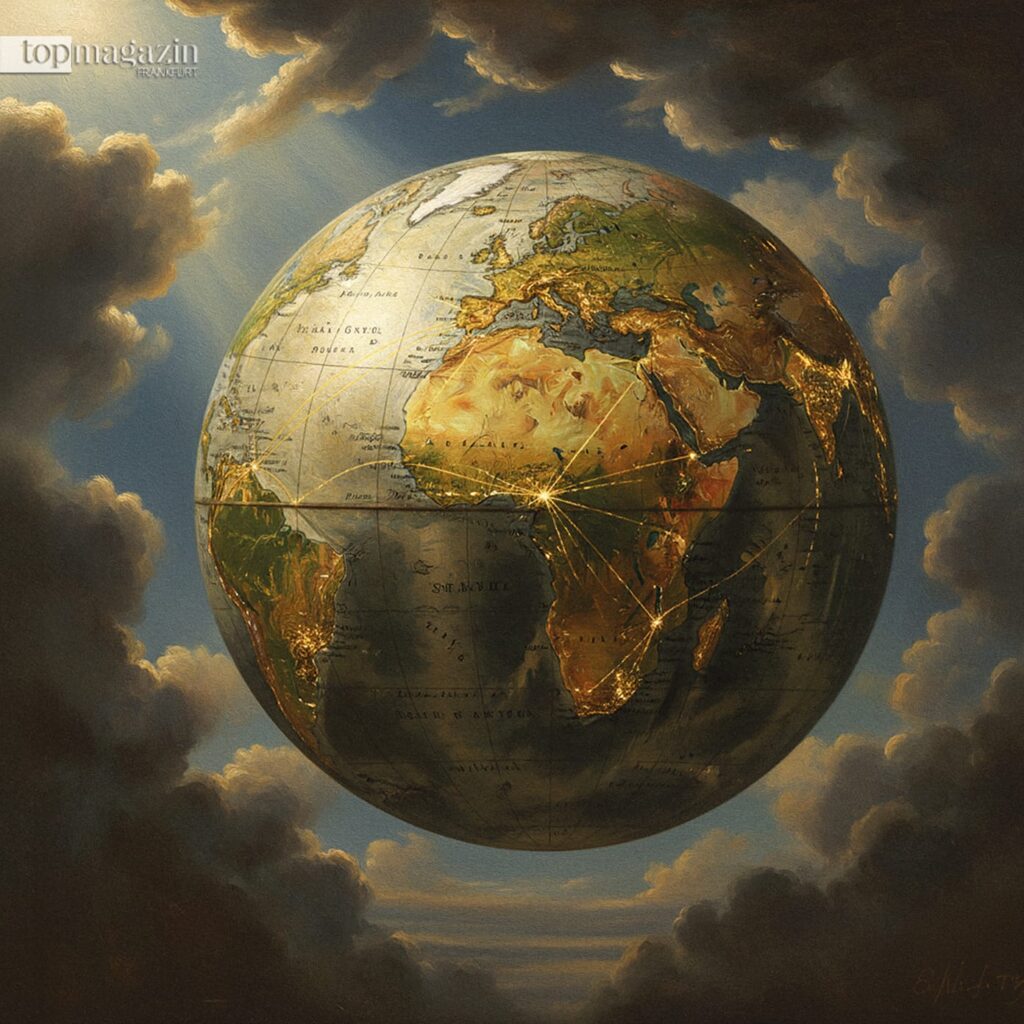
4. Gestörte Lieferketten und geostrategischer Druck
Viertens zeigt sich, dass die globalen Lieferketten – mühsam nach Corona neu justiert – gestört sind. Das sind nicht nur Zölle, sondern auch Sanktionen oder geopolitische Unsicherheiten wie Kriege. Oder Drohungen anderer Staaten. Zum Beispiel Wasserstraßen zu blockieren. Gesperrte Schifffahrtswege – das träfe wieder Europas Schlüssel-Industrien: Auto, Chemie, Maschinenbau. Wer geostrategisch begünstigt ist durch Lage, Zugangswege, Bodenschätze, nutzt seine Position immer öfter aus. Doch woher bekäme Europa Öl, Gas, Rohstoffe? Auf lange Sicht ein enormes Problem, für das Europa keine umfassenden Antworten hat.
5. Abhängigkeit im „Technologie-Krieg“
Bei Halbleitern, KI, Telekommunikation wird die EU indes in den „Technologie-Krieg“ der USA gegen China hineingezogen: Die USA hatten bestimmte Chip-Exporte nach China verboten. Europäische Unternehmen sind aber Zulieferer für BEIDE Länder. Und mussten sich nun für eins entscheiden. Zugleich ist Europa selbst abhängig von US-amerikanischer Technologie. Ein Wettbewerbsnachteil, der sich nicht über Nacht auflösen lässt.
Analyse: Wer sind die Gewinner des Zollstreits?
Die EU steckt in der Zwickmühle. China und die USA sind beide wichtige Handelspartner. Der Handelsstreit der beiden Mächte zeigt, wie stark die EU weder politisch noch wirtschaftlich davon profitiert. Ein Beispiel: Der Handelsüberschuss der EU mit ihrem wichtigsten Handelspartner USA ist im Juni eingebrochen: von gut 18 auf gut 9 Milliarden Euro. Aber wer ist der Gewinner in diesem Machtspiel? Die USA, sagt der US-Präsident. Verweist auf Einnahmen von 64 Milliarden US-Dollar aus Zöllen allein im zweiten Quartal. In der Vergangenheit brachten Zölle rund 80 Milliarden US-Dollar pro Jahr ein. Selbst die Inflation ist – anders als befürchtet – durch die Zölle nicht übermäßig gestiegen. Noch nicht. Die US-Wirtschaft wächst. Die Börsen steigen.
Das ist das, was Investoren wollen. Die Rally am Aktienmarkt kam zwar ins Stocken, als die Zölle aufkamen, das Vertrauen war angeschlagen in US-Wirtschaft, -Währung und -Politik. Doch das scheint momentan überwunden. Dazu kamen so genannte TACO-Trades. TACO steht für „Trump always chickens out.“ Trump kneift ohnehin. Tatsächlich hat der Präsident Zölle verhängt und ausgesetzt, Unternehmen mit Restriktionen überzogen und zurückgenommen. Ist vor China eingeknickt und auch vor Börsenverlusten. Hat erst die Börsen auf Talfahrt geschickt und ihnen dann Erholung beschert. TACO wurde zum geflügelten Wort, für manche zum schnellen Geld … Einmal mehr zeigt sich: Die Börse ist kein Ort von Moral. Hier geht es um Chancen, Risiken, Zukunft. Ums Geschäft.
Chinas wirtschaftliche Strategie: Die neue Seidenstraße als Gamechanger
Und China? Auf der weltpolitischen Bühne der strategische Gewinner. Zwar machen Zölle Waren teurer. Aber China hat einen Plan. Einen langfristigen: Den heimischen Markt stärken, um technologische und wirtschaftliche Abhängigkeiten wie bei KI zu senken, dafür andere Nationen von sich abhängig zu machen. Siehe Auto-Industrie. Siehe Rohstoffe. Das kann die EU nicht, weil ihre Produktionsstandorte viel zu teuer sind. Aus der Not von Zöllen macht China eine Tugend.
Beispiel KI und Chips aus eigener Hand. Wie weit der Aufbau wirklich gediehen ist, ist schwer zu sagen. Doch gerade veröffentlichte das KI-Start-up DeepSeek ein KI-Modell (also ein Computer-Modell, das menschenähnlich agiert, unfassbar viele Daten sammelt und verarbeitet), das extra mit chinesischen Chips funktionieren soll. Es reagiert damit auf den Schlagabtausch USA-China um die Chips des US-Unternehmens Nvidia. Nvidia durfte zeitweise keine leistungsstarken KI-Chips nach China liefern. Auf Anordnung des US-Präsidenten. Der ist zwar zurückgerudert. Jetzt schiebt Chinas Regierung selbst einen Riegel vor und will, dass chinesische Chips in KI-Modellen verbaut werden. So schnell ist die EU auf dem Gebiet nicht, kann nicht mithalten.
Einen der größten chinesischen Gamechanger gibt es seit 2013, die neue Seidenstraße, das größte Infrastruktur- und Investitionsprogramm der Welt. Mit hunderten Projekten in Asien, Europa, Afrika, Lateinamerika. Darunter Projekte wie der Hafen in Piräus in Griechenland, wichtige Tür für Chinas Lieferungen nach Europa. Lateinamerika ist ein Schwerpunkt: China ist Hauptfinanzierer von Venezuelas Ölindustrie, Investor in Brasiliens Energiesektor und in Argentiniens Schienennetz, damit Rohstoffe (Öl, Getreide, Lithium – alles, was die Länder bieten) an die Häfen transportiert werden können, an denen China wiederum beteiligt ist.
Der Hafen Chancay in Peru wird vom chinesischen Unternehmen Cosco ausgebaut. Er gilt als Chinas Tor nach Südamerika. Huawei baut 5G-Netze in vielen Ländern. Auch hier zeigt sich: Tempo, ein Plan und die Mentalität des unbeirrten Machens. Kurz: In Lateinamerika setzt China auf Rohstoffsicherung, auf Infrastruktur für den Export sowie auf digitale Infrastruktur. Mit Krediten und Deals. Die USA haben das verschlafen und investieren mit Fokus eher auf Mexico als Nachbarstaat. Zugleich haben sie Chinas Plan und Geschwindigkeit unterschätzt. Heute ist China der wichtigste Handelspartner vieler dieser Länder. Und warum?
Hase und Igel: Europas zähe Verhandlungen gegen Chinas Tempo
Die USA oder die EU verbinden wirtschaftliches Engagement oft mit politischen Auflagen zu Demokratie oder Umweltschutz. China nicht. So erreichte das Handelsvolumen zwischen China und Lateinamerika 2024 rund 518 Milliarden US-Dollar – ein Rekord. Das Volumen USA und Lateinamerika belief sich auf 363 Milliarden.
Und die EU? Auch sie hat Chinas Dynamik in Südamerika unterschätzt. Immerhin ist sie ein großer Investor in Branchen wie Energie oder Automobil. Aber Investitionen und Verhandlungen gehen langsam. Beispiel Mercosur: 25 Jahre brauchte eine Einigung auf das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Uruguay, Argentinien, Paraguay, Venezuela. Ja, Sie lesen richtig: 25 Jahre. Wie das?
Die EU rieb sich in langen Verhandlungen auf, und Detailfragen. Schnelle Finanzierungen und Entscheidungen machen diese Länder dann eher mit China. Auch wenn sie Europas Standards und Qualität eigentlich schätzen. Es ist wie bei Hase und Igel. Immer wenn der europäische Hase kommt, ist der chinesische Igel schon da.

Hase und Igel kann sich Europa nicht mehr leisten. Keine 25 Jahre. Es geht um die Zukunft des Alten Kontinents zwischen 27 Partnern mit 27 Interessen und viel Klein-Klein. Europa muss zusammenwachsen. Mit einer Stimme sprechen. Europas Börsen in Frankfurt, Athen, Madrid oder Budapest mögen derzeit rekordhoch stehen. Das zeigt Hoffnung. Die aber Erfolge braucht. Chinas Börsen waren lange hintendran. Seit dem Sommer holen die Kurse in Shenzhen und Shanghai rapide auf. Die Börse handelt die Zukunft.

Dieser Artikel erschien zuerst in unserer Print-Ausgabe. Sie wollen schneller informiert sein? Hier können Sie ein Abonnement abschließen.

