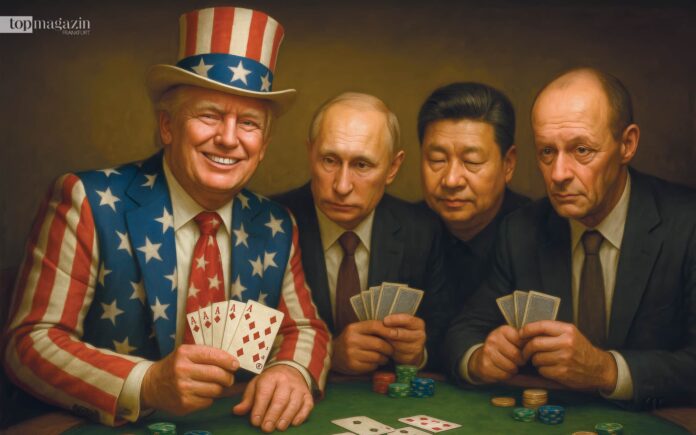Diesmal war er vorbereitet. Für seine zweite Präsidentschaft hatte Donald Trump einen Plan. Das war nur nicht der gleiche, den Investoren hatten. Und so gab es Vorschusslorbeeren am Aktienmarkt. Doch dann wurde das Oval Office zur Showbühne, der Hof am Weißen Haus zum Verkaufsraum für E-Autos und das Depot ein Trümmerhaufen. Und nun?
Inhalt
„Ich liebe Tesla.“ Vor dem Weißen Haus wirbt der US-Präsident Mitte März für Elektro-Autos von Tesla. Und Tesla-Chef Elon Musk kündigte an: Er werde die Produktion in den USA in den kommenden zwei Jahren verdoppeln. Na, wenn er sich das mal leisten kann. Und Käufer findet. Denn es war ein Wort, das die phänomenalen Kursverluste der vergangenen Monate – bei Tesla und am gesamten Aktienmarkt – zunichte gemacht hatte. Zölle. Auch auf Autos. 25 Prozent. Die Folge: Absatzeinbruch bei Tesla.
Kurz nach der Verkaufsshow vor dem Weißen Haus, am 2. April, dem „Tag der Befreiung“, wankten Weltmärkte, Unternehmen und lange bestehende Partnerschaften. US-Zölle gegen mehr als 90 Länder. Ein Hammer. Asien und Europa im Auge des Sturms. Ihre Antwort: Gegenzölle.

Handelskrieg – ein lange nicht benutztes Wort. Zuletzt 2021. Aber damals war die Weltwirtschaft – und auch die deutsche Wirtschaft – in besserer Verfassung. Und die Dimension der Zölle eine völlig andere.
Die Welt fragt: Wie weit eskaliert das Ganze? Eine Idee lieferte die Kurstafel: Seit Corona hatte der DAX nicht mehr gut 1.000 Punkte an einem einzigen Tag verloren. Inzwischen konnte er allerdings einige Verluste wettmachen, die US-Börsen auch.
Der US-Präsident musste jedoch zur Geduld aufrufen. Schwer, wenn zugleich Aktien, Anleihen und die Weltleitwährung, der US-Dollar, kollabieren. Wenn Investoren das Vertrauen verlieren. Und die Frage im Raum steht: Sind die USA noch der verlässliche, sichere Hafen für Anleihen und den Dollar?
Trumps Kehrtwende: Wie Zölle die globalen Märkte erschüttern
Die nächste Show musste her. Im Weißen Haus: Mitte April geht ein Video viral: „Er hat heute 2,5 Milliarden gemacht.“ Der Präsident zeigt auf den Investor Charles Schwab. Zuvor hatte Trump Zölle zeitweise ausgesetzt. Erfolg des „Dealmakers“?
Eher wirtschaftspolitischer Druck: China verhängte als Antwort auf immer höhere Import-Zölle Export-Kontrollen auf wichtige Rohstoffe wie Seltene Erden. Doch kein iPhone oder Auto funktioniert ohne sie. Das passt nicht zu „Make America great again“.
Ein Beben für die Weltwirtschaft: Diese Branchen leiden besonders
Zölle schaden allen – aber vor allen den USA. Die ersten Einigungen mit China und Großbritannien dürfen nicht darüber hinwegtäuschen: Die Zölle sind höher als bisher; es wird für alle Betroffenen teurer …
Deutsche Exportwirtschaft im Fokus: Von Maschinenbau bis Pharma
Was hat es im Portfolio besonders getroffen? Deutsche Unternehmen. Denn Deutschland ist in der EU der größte Exporteur in die USA. Maschinen, Anlagen, Auto-Teile. Auch belastet: Pharma-Unternehmen. Keine Branche bei uns exportiert mehr in die Vereinigten Staaten. Allein bei 20 Prozent Zöllen würden ihre US-Exporte um ein Drittel einbrechen, errechnete das ifo-Institut. Was das bedeuten kann? Produktionskürzungen, Arbeitsplatzverluste, vielleicht Werksschließungen. Die Aktien von Merck und Bayer reagierten entsprechend mit Kursverlusten.
Gerade im Markt für günstige Mode wie Zara (Inditex) und H&M können Zölle den Unterschied machen zwischen Gewinn und Verlust …
Einzelhandel und Banken: Einbrüche an der Börse
Auch an den Kursen von Einzelhändlern wie adidas zeigt sich: Zölle sind ein Hemmnis. Zunächst. Adidas produziert vor allem in China und Vietnam. Beide von der Zoll-Keule hart erwischt. Viele Mode-, Freizeit- und Sportartikel-Hersteller fertigen in Asien in Ländern, die nun besonders hoch bezollt würden. Aber gerade im Markt für günstige Mode wie Zara (Inditex) und H&M können Zölle den Unterschied machen zwischen Gewinn und Verlust … Immerhin – eine Überraschung der positiven Art gelang adidas im ersten Quartal: mehr Gewinn und Umsatz. Ein Hoffnungsschimmer.
Handelskriege, Wirtschaftsflaute, drohende Insolvenzen – an Banken geht so etwas ebenfalls nicht vorbei. Die verschlechterten wirtschaftlichen Aussichten brachten ihnen den größten Abverkauf an den Börsen seit zwei Jahren ein.
Automobilindustrie und Luxusgüter: Kernbranchen unter Druck
Besonders in Aufruhr: Autos. Für die deutschen Auto-Hersteller sind die USA der wichtigste Exportmarkt. Von den rund 770.000 Autos, die die EU in die USA exportiert pro Jahr, kommt mehr als die Hälfte aus Deutschland: Ca. 450.000 Fahrzeuge. Wer die Rede Trumps bei seiner Amtseinführung aufmerksam verfolgt hatte, dem war klar: Es wird nicht einfach für sie.
„Wir werden in Amerika wieder Autos bauen, und das in einem Tempo, das sich noch vor wenigen Jahren niemand hätte träumen lassen.“ Darauf folgten Zölle von 25 Prozent für Import-Autos. Für Verbraucher keine gute Nachricht und für die Auto-Industrie der USA ebenso wenig. Autos werden damit teurer. Und folglich weniger gekauft. Außer man heißt Ferrari und kann die Zölle problemlos an die Kunden weitergeben.
Lieferketten unter Druck: Das Mexiko-Dilemma
Viele deutsche Hersteller produzieren in den USA für die USA – aber nicht nur. Im Rahmen des Freihandels zwischen Mexico und den USA ließen sich Autos günstig dort produzieren, wechselten mehrfach die Grenze, bis das fertige Modell an US-Kunden ausgeliefert wurde. Auch amerikanische Hersteller machen das so.
Aus Mexico kommen nach Angaben der Mexican Association of Automotive Distributors AMDA 72 Prozent der Fahrzeuge, die die USA importieren. Keiner produziert in Mexiko so viele Autos wie General Motors. Mit Abstand. Auch Ford ist in den Top 5.
Was nun? Produktionsverlagerungen sind eine Möglichkeit. Ohnehin haben VW und Co. in den USA Fertigungen, die man ausbauen kann. Mercedes überlegt, ein weiteres Modell in den USA zu fertigen. Ein Notfallplan muss her. Lieferketten, Produktionen, Arbeitsplätze müssen geschützt werden. Ein weiteres Mammutprojekt.
Bumerang-Effekt: Wenn Zölle sogar Tesla treffen
Ironie der Geschichte: Selbst US-Hersteller leiden unter den Zöllen: Tesla bekommt 20 Prozent seiner Teile aus China. Tesla-Chef Elon Musk wollte das zunächst auffangen. Doch die Zölle stiegen und stiegen. Nicht machbar. Jetzt ruhen einige Produktionen. Als Berater von Trump war Musk gegen die Zölle – vergeblich. Die Tesla-Aktie auf Berg- UND Talfahrt. Erst hatten Investoren darauf gesetzt, dass gerade Musk für seine Unternehmen gute Deals aushandeln würde. Vom Hoch hatte die Tesla-Aktie zeitweise 50 Prozent an Wert verloren.

Bis zuletzt hatten die meisten auf Verhandlungen gehofft und darauf, dass die Auto-Zölle moderat ausfallen würden. Doch erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Die nächste Enttäuschung kommt jetzt: Einige Auto-Hersteller schütten weniger Dividenden an die Aktionäre aus. Das war nach den Schwierigkeiten der letzten Jahre absehbar, ist nach den Kursverlusten aber doppelt schmerzlich.
Luxusgüter: Wenn Zölle Gewinnmargen bedrohen
Ebenfalls wenig verschont: Luxus-Unternehmen. Aktien wie die britische Burberry, die französische LVMH oder die deutsche Birkenstock (die wir hier gar nicht als Luxus wahrnehmen, in den USA aber schon) kamen unter die Räder. Die Hersteller fertigen entweder in Europa (Zölle) oder in Asien (Zölle). Und für viele sind die USA ein wichtiger Absatzmarkt. Birkenstock exportiert rund die Hälfte seiner Schlappen dorthin, LVMH kommt auf rund 20 Prozent.
Anleger in der Zwickmühle: Von anfänglicher Euphorie zur Unsicherheit
Aber es sind nicht nur einzelne Unternehmen, Märkte, Branchen, Regionen, die von der Zoll-Lawine getroffen werden. Es ist eine Unsicherheit entstanden, die ich in 20 Jahren selten erlebt habe. Fatal für marktwirtschaftliches Arbeiten: Unternehmen, Investoren brauchen Planungssicherheit, Perspektiven.
Trumps ursprünglicher Plan: Ein Fest für Investoren?
Aber wie konnte es so schnell so weit kommen? Der Plan von Donald Trump klang doch zunächst wie Musik in den Ohren der Investoren: Der Wirtschaft weniger Regeln auferlegen, entbürokratisieren, Steuern senken. Dazu weniger Inflation und Benzinpreise nur noch halb so hoch wie unter der alten Regierung. Trump ist Unternehmer. Und er will die besten Bedingungen für Unternehmen in den USA schaffen.
Die Börse nahm die guten Aussichten an. Zu einer seit fast zwei Jahren laufenden Technologie-Rally gesellte sich ab September der breite Markt – schon vor der Wahl: Der Dow Jones stieg von 40.000 auf 45.000 Punkte Anfang Februar: der DAX von 18.500 Punkten auf über 23.400. Die schnellen Rekorde waren beängstigend.
Die Psychologie der Börse: Zwischen Übertreibung und Korrektur
Die Börse ist kein Ort von Moral, hier geht es darum, Chancen und Möglichkeiten für die Zukunft zu nutzen. Die Aussichten, in den USA, mit den USA weiter gut zu verdienen, schienen gut. Man darf nicht vergessen: Deutsche Groß-Unternehmen machen zu 80 Prozent ihre Umsätze im Ausland.
Die Börse ist aber auch ein Ort von Übertreibungen. Die über kurz oder lang korrigiert werden. Immer. 2002 verloren US-Aktien fast 50 Prozent an Wert, 2020 rund ein Drittel. Es fühlte sich jedes Mal ein wenig an wie das Ende der Welt. War es nie.
Fehleinschätzung mit Folgen: Warum die Märkte Trumps Entschlossenheit unterschätzten
Und die Zölle? „Auf Sicht fahren“, hieß es an der Börse. Und: „Wird schon nicht so schlimm kommen.“ Denn die Erwartung der meisten Investoren war: Zunächst räumt Trump zu Hause auf: in Wirtschaft und Behörden. Zölle kommen später. Wie in der ersten Amtszeit. Doch wer seine Rede zur Amtseinführung aufmerksam verfolgt hat, hat gut daran getan, sein Depot defensiver auszurichten.
An Tag 1 der Amtszeit stellte Trump bereits Zölle in Aussicht. Warum? Er will doch das tägliche Leben der Amerikaner günstiger machen? Mit diesem Versprechen hatte er die Wahl gewonnen. Die Realität: „Diese Zölle sind die größte Steuererhöhung in den USA in mehr als 50 Jahren“, schrieben die Ökonomen der Deutschen Bank.
Trump versuchte, als Ausgleich die Notenbank zu niedrigeren Zinsen zu bewegen. Drohte, deren Chef zu feuern. Man muss sich das vorstellen: eine unabhängige Instanz wie die Notenbank. Erfolglos: Aktien, Anleihen, Dollar gingen in die Knie. Schon wieder.
Die Stimmung ist gekippt. Inzwischen ist sie da, die Sorge vor einer Rezession der USA – einer Phase wirtschaftlicher Schwäche. Das Vertrauen US-amerikanischer Verbraucher fällt. Ökonomen senken ihre Prognosen für die US-Wirtschaft.
Sichere Häfen sind so was von gefragt: Der Schweizer Franken. Das Land mit solidem Wirtschaftswachstum, niedriger Inflation und einer starken Währung ist DIE Anlaufstelle im Krisenfall.
Flucht in die Sicherheit: Die wenigen Gewinner der Krise
Aber es gibt auch Gewinner. Diese Liste ist etwas kürzer. Sichere Häfen sind so was von gefragt: Der Schweizer Franken. Das Land mit solidem Wirtschaftswachstum, niedriger Inflation und einer starken Währung ist DIE Anlaufstelle im Krisenfall.
In Krisen sind auch Anleihen solider Staaten gesucht: etwa deutsche. Seit Mitte März steigt die zehnjährige Bundesanleihe wieder. Die Renditen fallen. In der Schweiz war der Zins für kurzlaufende Anleihen sogar zeitweise negativ …
Und Gold ist rekordteuer. Hier war der 14. März 2025 ein Meilenstein. Zum ersten Mal kostete Gold an dem Tag über 3.000 US-Dollar. Kein Grund zum Jubeln – denn Gold ist eine Krisenwährung. Und derzeit ist vielen die Unsicherheit auf die Stirn geschrieben: Schaut man auf den Index für wirtschaftspolitische Unsicherheit, den weltweiten Economic Policy Uncertainty Index, zeigt sich: Nie in den vergangenen 25 Jahren war die Unsicherheit weltweit so groß …
Der Weckruf für Europa: Neue Chancen durch strategische Autonomie?
Aber schauen wir auf Lichtblicke. Mit dem Ende der jahrzehntelangen guten wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den USA, der transatlantischen guten politischen Beziehungen und des militärischen Schutzes muss Europa selbstständig werden.
Beispiel Sicherheit: Vor dem Zoll-Hammer schwelte eine Debatte, ob die USA da noch verlässlich sind. In den vergangenen drei Jahren war Europa klar geworden: Sicherheit ist ein hohes Gut. Und teuer. Aber da hielt noch der Schutzschirm der USA … Und jetzt?
Sagen wir es mal so: Zum Glück spielt die EU wirtschaftlich in einer höheren Liga als militärisch. Es ist der größte Wirtschaftsraum der Welt. Den möchte Trump nicht als Handelspartner verlieren. Zugleich ist es Zeit, neue Handelsbündnisse auf- und auszubauen. Es darf aber nicht Jahrzehnte (!) dauern, bis – wie im Falle Mercosur – neue Freihandelsabkommen stehen.
Rüstung und Infrastruktur: Deutschlands neue Investitionsziele
Und es wird Zeit, sich selbst verteidigen zu können. Die Chancen – abzulesen bei Rüstungsaktien. Rheinmetall-Aktien haben sich allein seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt in ihrem Wert. Von 600 Euro auf mehr zeitweise 1.400 Euro. Rüstung –
ein absolut kontroverses Thema, keine Frage.
Mit dem Investitionsplan der neuen Regierung in Verteidigung und Infrastruktur war – kurz vor den Zöllen – tatsächlich etwas Optimismus in die Wirtschaft zurückgekehrt. Geld für die Sanierung maroder Straßen, Brücken und Schienen, für den Wohnungsbau: Deutschland war plötzlich wieder das Land, das einen Plan hatte. Der wird teuer. Aber: Und da sind wir wieder bei Börse und Investitionen: Unternehmer und Investoren nehmen dann Geld in die Hand, wenn sie glauben, dass sich ihre Erwartungen erfüllen. Dann sind sie bereit, Risiken einzugehen. Die Rüstungsbranche gehört zu den Profiteuren dieser Pläne.
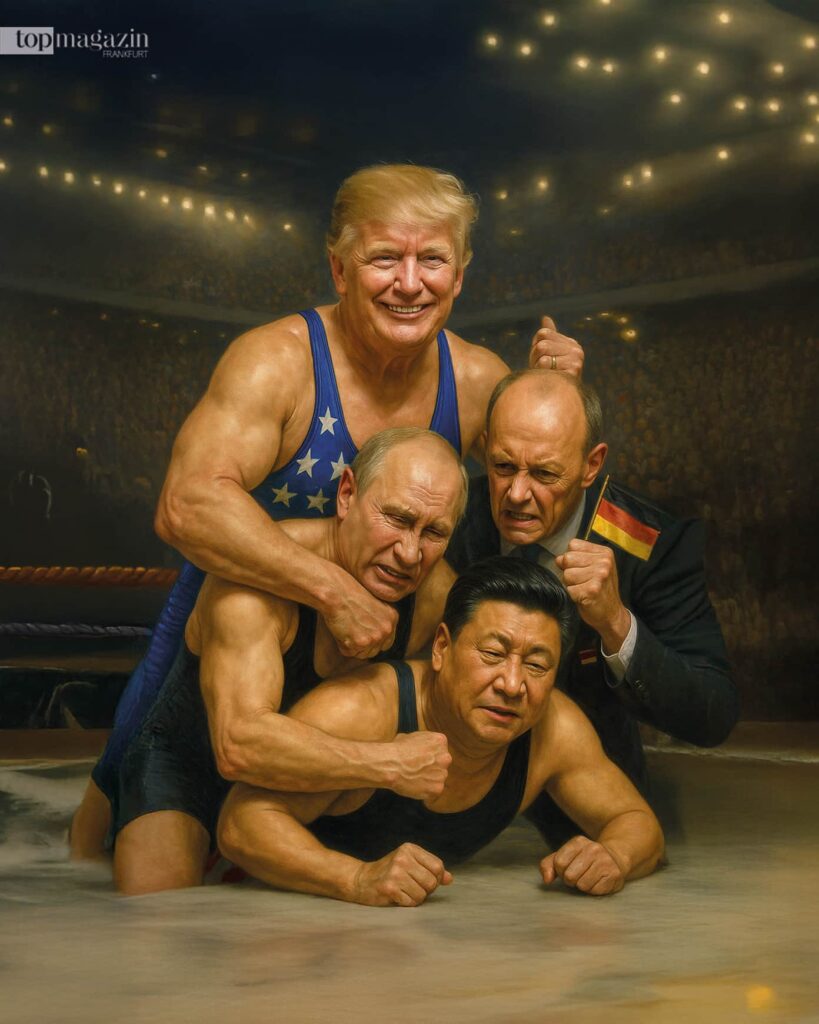
Standort Deutschland: Ein attraktiver Hafen für Investoren?
Aber wir sehen auch, dass jüngst Immobilien-Aktien gestiegen sind. Sanieren, bauen, erweitern – die geplanten Milliarden sinnvoll einsetzen. Es geht darum, dieses Land wieder flottzukriegen. Standort Deutschland – gar nicht so schlecht?
Aber selbst in schwierigen Zeiten sehen Investoren offensichtlich hier eher die Vorteile als wir selbst: Die vergleichsweise hohe Sicherheit, die politische Stabilität, die Qualifikationen der Beschäftigten, die Fähigkeit zu erfinden, zu entwickeln, umzusetzen. Gut jede zweite DAX-Aktie ist in ausländischer Hand, ermittelte die Wirtschaftsberatung EY.
Fazit: Börsen sind kein Ort von Moral – aber der Ort, an dem die Zukunft gehandelt wird. Die Auswirkungen der Zölle sind komplex. Sie können über Jahre anhalten. Gewachsene Strukturen schädigen. Oder positiv verändern.
Dieser Artikel erschien zuerst in unserer Print-Ausgabe. Sie wollen schneller informiert sein? Hier können Sie ein Abonnement abschließen.