ChatGPT revolutioniert das Leben. Kein Tag vergeht, an dem nicht darüber geschrieben wird. Das textbasierte Dialogsystem hat der Künstlichen Intelligenz (KI) noch einmal einen Push gegeben. KI ist sprachfähig geworden. Manche fürchten zwar, bald von Robotern abgehängt zu werden. Aber sehr viele wollen dabei sein und von der Intelligenz-Explosion profitieren – vor allem in der Wirtschaft.
Inhalt
Sebastian Heinz war mit der KI früh dran. Vor zwölf Jahren gründete er in Frankfurt nach dem Betriebswirtschaftsstudium das KI-Technologieunternehmen statworx.
Seine Firma hat er nach und nach auf 80 Mitarbeiter aufgestockt. Er bietet KI-Beratung und Lösungen in den Bereichen Data Science sowie Machine Learning an und ist als Investor für KI-Start-ups tätig. Mit mehr als 500 Projekten hat sich statworx zu einem wichtigen KI-Player im deutschsprachigen Raum entwickelt. Der Macher versteht sich als Teil einer internationalen Community und bevorzugt deshalb die englische Bezeichnung Artificial Intelligence oder kurz AI.

ChatGPT pusht KI
Wie funktioniert KI eigentlich? Ein künstliches System lernt aus Beispielen und kann nach Ende der Lernphase daraus Muster und Gesetzmäßigkeiten erkennen. Dabei helfen Algorithmen und statistische Modelle. Das klingt erstmal recht harmlos. Und doch haben selbst einige berühmte KI-Pioniere inzwischen das Gefühl, dass ihnen etwas entgleiten könnte. Politiker verlangen bereits strenge Regulierungen.
Das Erscheinen von ChatGPT hat Panik ausgelöst. Open AI hat mit Hilfe von Microsoft den Chatbot auf den Markt gebracht. Bill Gates verwahrte sich im Februar gegen Versuche, die Entwicklung zurückdrehen zu wollen. „Die Milliarden, die Software- und Digitalunternehmen investieren, sind größer als die Forschungsetats von Regierungen“, warnte der Microsoft-Gründer vor unnötigen Restriktionen.
„Die Milliarden, die Software- und Digitalunternehmen investieren, sind größer als die Forschungsetats von Regierungen.“ -Sebastian Heinz, AI Frankfurt Rhein-Main
Die Konkurrenz ist alarmiert vom Vorsprung, den sich Open AI bei der KI-Sprachsoftware verschafft hat. Elon Musk forderte zwischenzeitlich einen Entwicklungsstopp. Das klang beim Tesla- und Twitter-Chef wie der Ruf nach einer Auszeit, damit er Open AI ein- und überholen könne. Inzwischen ist es ein offenes Geheimnis, dass Musk ein Konkurrenzunternehmen plant.
AI-Hub für Rhein-Main
Ein Pragmatiker wie Sebastian Heinz kümmert sich nicht groß um die Machtspiele der amerikanischen Digitalkonzerne. Ihm geht es einfach darum, die Frankfurter KI-Szene enger zu vernetzen. Etwas neidisch schaut er nach Berlin, wo man schon viel weiter ist. Dort ist vor mehr als zwei Jahren der Merantix AI Campus eröffnet worden. In einem modernen Gebäude stehen 5400 Quadratmeter für rund 450 Developer und Unternehmer zur Verfügung.
Etwas Ähnliches schwebt dem Hessen auch für das Rhein-Main-Gebiet vor. „Wir sind leider noch etwas zurück“, beklagt der KI-Promotor, der mit seinem Hipster-Bart gut in die Hauptstadt passen würde. Der AI Hub Frankfurt, der jetzt mit ihm als CEO startet, möchte rasch ein „Ökosystem“ installieren, in das Investoren, Industrie, Start-ups und Entwickler eingebunden sind. Wichtige Zusammenschlüsse zur Stärkung der Region wie die Frankfurt RheinMain GmbH, die Wirtschaftsinitiative Frankfurt und der AI Frankfurt Rhein-Main e.V. machen mit. Auch Technologieunternehmen wie Google und Microsoft unterstützen die Initiative.
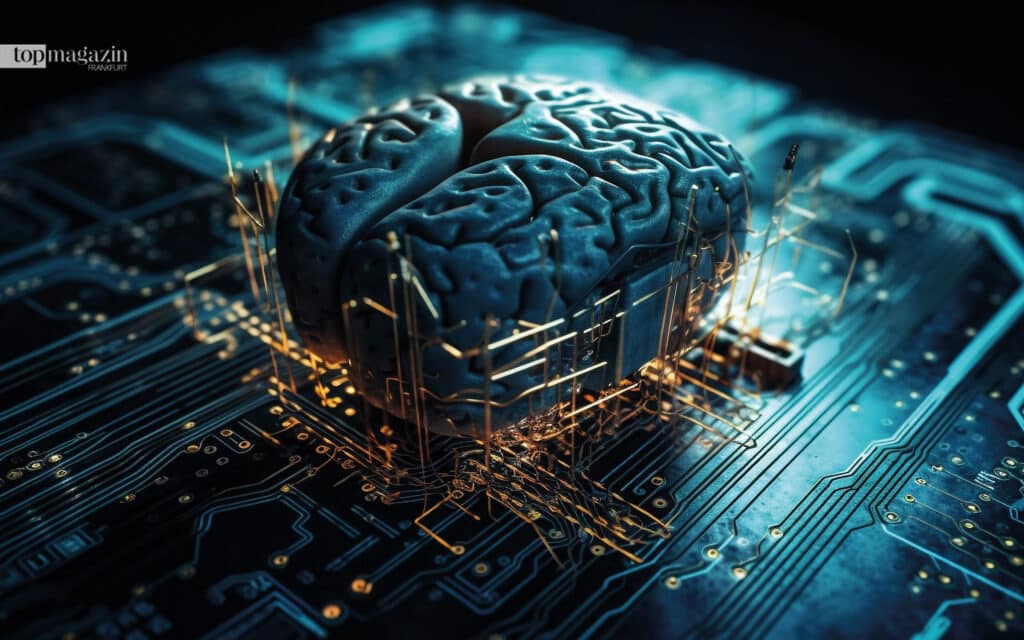
„Wir werden KI-Wissen durch Workshops und Veranstaltungen fördern, Schulungen durchführen und talentierte KI-Fachkräfte an Unternehmen vermitteln – auch KI-Start-up-Programme sind geplant“, kündigt der 41-Jährige an. Heinz träumt von einem KI-Campus an der Zeil, „wo genug Flächen leerstehen“. So bekäme die City neue Impulse. „Unsere Mission ist, das in der Region vorhandene Potenzial an Daten und KI zu entfalten“, formuliert er kämpferisch.
Campus für Künstliche Intelligenz
KI statt Kaufhäuser? Die praktischen Vorteile von KI seien doch offensichtlich, betont Sebastian Heinz. Sicher würden auch Arbeitsplätze wegfallen. Doch neue Jobs und Unternehmen würden dafür sorgen, dass das Rhein-Main-Gebiet weiter wettbewerbsfähig bleibe.
„Unser AI-Hub wird gerade auch Start-ups fördern und dazu beitragen, dass wirtschaftsnahe KI-Produkte am Main entwickelt werden.“ Frankfurt mit seiner ökonomischen Potenz sei ein idealer Standort. Das erkenne allmählich auch die Stadt.

Rund 50 Kilometer von Frankfurt entfernt – bei Engelbert Strauss in Biebergemünd – hat die KI-Ära schon richtig Fahrt aufgenommen. Im nahen Schlüchtern hat Europas führender Hersteller von Berufskleidung und Sicherheitsschuhen vor wenigen Jahren eine hochmoderne CI-Fabrik errichtet. Produktion, Branding oder Logistik werden dort von KI gesteuert. An seinem Hauptsitz im idyllischen Kinzigtal lässt sich das trendige Unternehmen nun durch Künstliche Intelligenz sogar beim Design inspirieren.
Zukunftswerkstatt im Kinzigtal
Im architektonisch imposanten Campus wird an futuristischen Lösungen getüftelt. Die Kollektionen von morgen sollen KI-gestützte Schöpfungen sein. Henning Strauss, der Enkel des Gründers, verantwortet die Bereiche Marke, Produkte und Strategie. Zügig treibt er die Entwicklung zusammen mit seinem Bruder Steffen voran.

Die Besucher des Top Magazins empfängt Henning Strauss leger in einem großen lichten Raum mit weißem T-Shirt und weißen Schuhen – natürlich aus dem eigenen Haus. Dazu trägt er eine grüne Designerhose aus Japan. Seine Frau, die Kreativdirektorin, grüsst lässig von der Galerie. „Dies ist mein Arbeitszimmer“, sagt er.
In den vergangenen gut zwanzig Jahren hat die Firma den Umsatz verzwanzigfacht. „Die Menschen wollen echte Sachen“, kommentiert der Marktforscher Sebastian Buggert den Strauss-Erfolg. Es gebe eine „analoge Sehnsucht nach dem Greifbaren“ in einer zunehmend virtuellen Welt.
Das heißt nicht, dass sich das Familienunternehmen mit Bodenständigem begnügen will. Im Gegenteil. Es hat sich auf eine galaktische Reise begeben. „Mit KI können wir einfach noch kreativer sein“, sagt Henning Strauss.
„Mit KI können wir einfach noch kreativer sein.“ – Henning Strauss, Engelbert Strauss
Galaktische Abenteuer
Großvater Engelbert, der das Unternehmen nach dem Krieg gründete, hatte ursprünglich noch Besen und Bürsten verkauft. Dann fokussierte man sich auf Arbeitskleidung. Inzwischen wird der modische Aspekt immer wichtiger. Auch die Jeans, einst eine robuste Goldgräberkluft, ist schließlich einen ähnlichen Weg gegangen. Die Workwear von Engelbert Strauss in modernen Schnitten und Farben ist Kult geworden – nicht nur bei Leuten, die Funktionskleidung tragen müssen. Das Anpacker-Image ist wie maßgeschneidert für den Mittelständler.


Henning Strauss, der Betriebswirtschaft in Los Angeles studiert hat, liebt Fashion. In der Schule glaubte er, nicht kreativ zu sein. Er tat sich nämlich beim Zeichnen schwer. „Inzwischen kann ich meine Fantasie auf andere Art einbringen“, stellt er fest. Neben ihm sitzt Konzeptdesigner Markus Sohlbach. Beide erklären in der nächsten Stunde, was sie vom KI-Design erwarten.
Gerade haben die zwei einen Ausflug zum Mars unternommen. Natürlich nur in einem Szenario. Die Idee war, den Planeten zu kolonisieren mit Kleidung von Engelbert Strauss. Die KI lieferte dazu das Design. „Damit wollten wir die Kollegen im Haus mit dem Thema vertraut machen“, verrät der Chef. „Ich selbst war verblüfft, was dabei herausgekommen ist.“


Mit Kollegen zum Mars
Die Stimmigkeit sei überraschend gewesen, erzählt der 46-Jährige. Das System kenne selbstverständlich die eigene Firmensprache. Es habe dann auch Bilder von Astronauten gefunden, was für den Auftrag nützlich gewesen sei. Dann zeigt er die Entwürfe in den Firmenfarben Rot und Weiß. Sie lassen an eine sportlich-heitere Expedition ins Weltall im typischen Strauss-Look denken. Die Klamotten sehen nicht nach wilder Science-Fiction aus. Sie wirken sehr tragbar.
„Die Präsentation hat bei unseren Mitarbeitern für großes Aufsehen gesorgt“, berichtet Henning Strauss. „Der Versuch sollte zum Nachdenken anregen, was Künstliche Intelligenz für uns bedeuten kann. Ich glaube, die meisten haben begriffen, dass das Thema kein ferner Ausblick ist, sondern uns alle schon heute angeht.“
Die Gestaltung eines Pop-up-Stores für Kids in der Frankfurter My Zeil, der im September seine Tore öffnet, wird von der spielerischen Tour ins All profitieren. „Wir haben unser Experiment für die Kommunikation in den Social-Media-Kanälen genutzt und starke Resonanz erhalten. Das hat uns motiviert, Elemente aus der Tour zum roten Planeten bei der Gestaltung des Ladens wiederzuverwenden. Ich glaube, die Jungs und Mädchen mögen das.“
Tragbare Science-Fiction
Der Vater von zwei Jungen freut sich, demnächst in Frankfurt mit einem absoluten Zukunftsthema zentral und prominent vertreten zu sein. Sich immer wieder herauszufordern und Zeitströmungen früh zu erkennen, gehört zur Philosophie des Unternehmens. Auch Konzeptdesigner Sohlbach musste sich dem stellen. Noch immer skizziert er gern auf Papier, bevor er etwas digital umsetzt. Dennoch ist er zu einem KI-Experten geworden.
Er ist von den Möglichkeiten, die KI bietet, fasziniert. Bis vor Kurzem habe man Tausende von Fotos durchforsten müssen, um sich beim Design anregen zu lassen. Inzwischen würden die Algorithmen blitzschnell Ergebnisse präsentieren.
„Beim Generieren von Entwürfen kommt es darauf an, dass die eingefütterten Informationen die Richtung vernünftig vorgeben. Ohne guten Input“, so Markus Sohlbach, „kein guter Output.“ Derzeit drehe die KI zwar noch ein paar Pirouetten zuviel, räumt er ein. „Aber das Schnörkelige lässt sich leicht korrigieren.“ Der Siegeszug der KI wirkt unaufhaltsam.
Jobkiller oder Retter?
Die Prognosen sind eindeutig. „Ab 2035 wird es keinen Job mehr geben, der nichts mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat“, verkündet Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Der digitalaffine Wirtschaftsjournalist Holger Schmitt weist daraufhin, dass im ersten Quartal 2023 die Nachfrage nach KI-Fachleuten sprunghaft gestiegen sei. „Mit ChatGPT sind die Einsatzfelder spürbar gewachsen“, konstatiert er. Schmitt ist überzeugt, dass die Technologie in der Summe mehr Jobs schaffe als zerstöre.

Arvind Krishna, CEO bei IBM, ist zumindest auf kurze Sicht skeptischer. Er geht beispielsweise von einem Einstellungsstopp bei Verwaltungstätigkeiten aus, die künftig von KI erledigt werden könnten. Auf diese Weise würden in einem Zeitraum von fünf Jahren 30 Prozent der Arbeitsplätze entfallen.
Wenn man sieht, wie rasch eine ChatGPT-Version der anderen folgt, scheint das nicht völlig aus der Luft gegriffen. Das aktuelle Modell ChatGPT4 beherrscht die menschliche Kommunikation bereits ziemlich perfekt. Selbst komplexe Fragen werden in der Regel richtig beantwortet. Die Verarbeitungskapazität ist gewaltig, verbraucht dadurch aber auch eine Menge Energie. Noch tauchen Fehler auf. Die Tonalität der Antworten stimmt bisweilen nicht oder sie sind komplett daneben. Aber wie lange noch?
Enrico Schleiff, der Präsident der Frankfurter Goethe-Universität sieht keineswegs schwarz. Im Gegenteil. Programme wie ChatGPT könnten helfen, Bildung zu verbessern. Die Art und Form der universitären Lehre werde sich verändern, „weg von der Wissensvermittlung, hin zur Unterstützung bei der Informationsbewertung.“
„Die Art und Form der universitären Lehre wird sich verändern, weg von der Wissensvermittlung, hin zur Unterstützung bei der Informationsbewertung.“ – Enrico Schleiff, Goethe-Universität Frankfurt
Auch Roboter leiden
Die Einschätzungen mögen divergieren. Aber dass das Thema KI wichtig ist, dürfte kaum jemand bestreiten. Nichts scheint mehr ohne die Hilfe der Algorithmen zu klappen. Alle geben vor, KI zu nutzen oder möchten wenigstens darüber reden. Der Frankfurter Kunstverein fragt „Wie verändert Künstliche Intelligenz unsere Kultur?“ Speisen und Cocktails „à la KI“ offeriert ein Pop-up-Restaurant in der Frankfurter Innenstadt. Und auch die Broker werben mit KI für ihre Aktienplattformen.
Könnte sogar der Umgang mit dem Tod ein anderer werden? „Wiederauferstehen und unsterblich werden – als Künstliche Intelligenz“ lautete der Titel eines Themenabends der Polytechnischen Gesellschaft im Haus am Dom aus dem vergangenen Herbst. Nähern wir uns jetzt schon himmlischen Zuständen?
Wohl kaum, beruhigt der weltbekannte KI-Forscher Jürgen Schmidhuber die erhitzten Gemüter. Das Leiden werde nicht verschwinden. Selbst nicht bei Robotern. Man pflanze ihnen nämlich gezielt Schmerzsensoren ein. Die reagierten, wenn die Humanoiden gegen ein Hindernis stoßen. „Das Leiden ist fundamentaler Bestandteil des Lernens, was wiederum fundamental für moderne KI ist“, sagt er. „Eine KI, die nicht leidet, hat keine Motivation, etwas zu lernen, um dieses Leiden abzustellen.“ Das Leben ist also auch künftig kein Ponyhof – nicht einmal für künstliche Intelligenzbestien.
Dieser Artikel erschien zuerst in unserer Print-Ausgabe. Sie wollen schneller informiert sein? Hier können Sie ein Abonnement abschließen.

